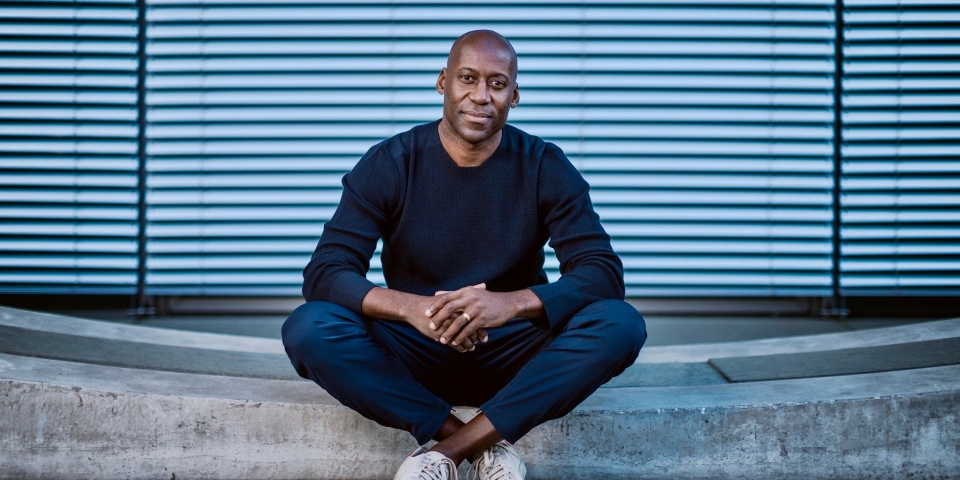Die Frage ist eine alte: Sind die Kirchen, besonders die evangelisch-reformierten Landeskirchen, zu links? Die Diskussion darüber neu ausgelöst hat vor einigen Monaten ein Artikel in der „Weltwoche“ unter dem Titel „Jesus würde SP wählen“. Der Journalist Urs Paul Engeler behauptet darin, die Kirchen hätten in den letzten Jahren immer direkter und einseitiger Politik gemacht – eben linke. Als Beispiele werden Stellungnahmen des Schweizerischen Evangelischen Kirchenbundes (SEK) gegen den Irak-Krieg, gegen die Asylinitiative oder der offene Brief an die Schweizerische Volkspartei SVP wegen ihres Ratten-Plakates angeführt. Auch die „Wort zum Sonntag“-Sprecher missbrauchten die Fernsehkanzel immer wieder für einseitig links-grüne Kampfvoten vor Abstimmungen, moniert der Autor des Artikels. So habe der reformiete Pfarrer Jörg Fehle vor dem Urnengang vom 16. Mai dargelegt, ein Nein zum Steuerpaket sei aktuelle Christenpflicht. Nicht besser kommen die Kirchenboten der reformierten Kantonalkirchen weg. Die Kirchenjournalisten werden nach Meinung des „Weltwoche“-Artikels mehrheitlich in der linken Fraktion vermutet. Als Beispiel muss unter anderen der „Saemann“, der Kirchenbote der Berner Kirche, mit einem Leitartikel von Kurt Zaugg herhalten, der klar für ein Nein zum Avanti-Gegenvorschlag plädierte. Viele weitere Stellungnahmen aus den Reihen der reformierten Landeskirchen werden im Artikel genannt, allesamt linke und grüne Voten im Leitbild von Friede, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung. Die Tendenz des Textes ist auch eindeutig: Die Kirche solle sich mehr um Verkündigung der frohen Botschaft kümmern und sich weniger in die Politik einmischen – und wenn schon, dann politisch ausgewogener. Dass sich die Katholiken sowie die Evangelische Allinaz und die Freikirchen vor allem in Familien- und sexualethischen Fragen eher im konservativen Bereich der politischen Skala positionieren, nimmt der Autor des Artikels nicht wahr. Mit einer gewissen Genugtuung nahm offenbar SVP-Nationalrat Christian Miesch aus dem Baselland den „Weltwoche“-Beitrag zur Kenntnis. Er stimmt seinem Inhalt in einer Kolumne im „Baslerstab“ zu. Der SEK fasse jeweils Parolen, ohne die Basis zu befragen, klagt Miesch. „Was sollen wir tun? Nebst den Kirchensteuern müssen wir in unseren Kirchen Gegensteuer geben: Die Kirchen dürfen wir auf keinen Fall ein paar wenigen überlassen.“ Sie müsse wieder „auf den rechten Weg“ gebracht werden. Wie sehen dies eigentlich Pfarrerinnen und Pfarrer an der Basis in der reformierten Kirche? Von solchen, die in ihrer theologischen Basis der Evangelischen Allianz nahe stehen, wollten wir wissen, wie sie mit den politischen Aspekten in der Bibel umgehen. Nachfolgend die Antworten von sieben Pfarrern und einer Pfarrerin. 1. Finden Sie es grundsätzlich richtig, dass sich die Kirche in die Politik einmischt? Oder soll sie sich aufs „Kerngeschäft“ beschränken? A) ALFRED AEPPLI ist Pfarrer der evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Jegenstorf-Urtenen BE zu 1: Die Kirche kann sich nicht anders verhalten, als dass ihr Wesen auch eine öffentliche Ausstrahlung hat. Die Kernbotschaft von Christus lautet: „Das Reich Gottes ist nahe herbei gekommen!“ Das Gottesreich ist zwar noch nicht vollständig da, aber wir erwarten dessen Vorboten schon jetzt. Glaube, Liebe und Hoffnung sollen die ganze Breite des Alltags durchdringen. Das ist auch eine öffentliche Sache. Wer den Glauben bezeugt und danach handelt, nimmt damit implizit auch Stellung zu politischen Angelegenheiten. zu 2: Das Evangelium lässt sich weder links noch rechts einordnen. Christus hat sich immer auf die Seite der Benachteiligten gestellt. Das wäre eher links. Aber er hat auch an bleibenden Werten festgehalten, was vermutlich eher rechts wäre. Politik nach dem Neuen Testament stellt die Schwachen in den Vordergrund, gewichtet den Menschen mehr als die Sache und fragt nach den langfristigen Folgen. Sie fällt die Entscheidungen aufgrund einer soliden Wertebasis. zu 3: In der Predigt sage ich den Gemeindegliedern nicht, was sie stimmen sollen. Die Tagespolitik bespreche ich lieber im persönlichen Gespräch. Aber ich mache immer wieder deutlich, auf welchen ethischen Grundlagen ich meine Entscheidungen treffe. Meine Gemeinde reagiert sehr positiv darauf. Und es gibt immer wieder anregende Gespräche. Ich respektiere die Meinung der andern, sage aber auch, was mich bewegt. B) ANDREA FABRETTI ist Pfarrer der evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Berg TG zu 1: Natürlich soll sich die Kirche zu politischen Themen äussern, aber nur, wenn es sich aufdrängt, und nicht zu oft. Wie sollte es anders gehen? Alles, was Jesus sagte und lehrte, hat gesellschaftliche Relevanz. Was oft fehlt, sind begründete Aussagen; also die Rechtfertigung, warum sich die Kirche zu welchem Thema wie äussert. Leider haben wir Evangelischen hier Schwierigkeiten, einerseits mit einer klaren Stimme zu reden und andererseits wahrgenommen zu werden. zu 2: Das Evangelium ist ein Korrektiv für alle Ideologien, von denen niemand ganz frei ist. Darum ist das Evangelium weder rechts noch links. Die Kirchen sind es dagegen zu oft: Landeskirchen entschieden zu links, die meisten Freikirchen (Ausnahme: Mennoniten) entschieden zu rechts. zu 3: Gut, da ich mich damit sehr zurückhalte. Wenn ich etwas sage, dann weiss ich auch warum. Ich betreibe keine Parteipolitik und kritisiere rechts wie links gleichermassen. C) MARTIN HOHL ist Pfarrer der evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Bretzwil BL zu 1: Ich finde es richtig, dass wir uns in die Politik einmischen, allerdings weniger in Abstimmungen als in grundsätzlichen Aussagen. Wir können und sollen konkrete Zustände und Entwicklungen anhand des Evangeliums beurteilen oder kritisieren. Da wir einzig Jesus Christus als obersten Herrn aller Herren akzeptieren, sind wir anderen Herrschaftsansprüchen gegenüber grundsätzlich kritisch eingestellt. zu 2: Das Evangelium übersteigt Links-rechts-Schemen und Parteien. Einerseits gibt es eine Parteinahme für die Schwachen, Armen, Kranken etc. und so Verständnis für linke Politik (Umverteilungs- und Sozialpolitik, Verhinderung von Ausbeutung). Andererseits finden wir auch Grundlagen für bürgerliche Politik: Schutz des Privateigentums, Förderung der Würde und Eigenverantwortung, Schaffung von Voraussetzungen und Rahmenbedingungen für wirtschaftliche Prosperität. zu 3: Mitglieder würden negativ reagieren, wenn ich auf lokaler Ebene für oder gegen konkrete Projekte oder Kandidaten eintreten würde. Hier ist Politik auf der Kanzel tabu. Die Gemeinde sollte Heimat bieten für alle. Aber grundsätzliche Aussagen sollten wir dennoch machen. Wir sollten uns keinen politischen Maulkorb umbinden (lassen), aber vor allem auf lokaler Ebene mit Parteinahme vorsichtig sein. D) MAX HARTMANN ist Pfarrer der evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Brittnau AG zu 1: Für mich ist klar, dass sich der christliche Glaube nicht auf Innerlichkeit und „Seelenheil“ beschränken lässt. Jesus Christus will Herr sein über das ganze Leben. Als Christen müssen wie uns einmischen. Was mich jedoch stört, ist, wenn kirchliche Organisationen zu viele einseitige konkrete politische Stellungnahmen abgeben und damit den Eindruck erwecken, dass diejenigen, die es aus ihrer Sicht anders beurteilen, „schlechte Christen“ sind. zu 2: Das Vorbild ist Jesus Christus. Er hat es gewagt, die Mächtigen zu kritisieren, sich aber dem Dialog nie verweigert. In gewissen Anliegen sehe ich eine Nähe zu linken Anliegen: im Einsatz für Randständige oder in der Kritik überrissener Managerlöhne. Anderes dagegen, was mir aus christlicher Sicht wichtig ist, wie vielfältige Markwirtschaft, Schutz der Ehe und des ungeborenen Lebens, Kampf gegen wachsende Kriminalität und Sozialgesetzmissbrauch sind wohl eher rechte Anliegen. zu 3: Von vielen werden kirchliche Stellungnahmen kaum wahrgenommen. Es interessiert sie schlicht nicht, was die Kirche denkt. Einige wenige regen sich über die Einseitigkeit bzw. Inkompetenz gewisser Stellungnahmen auf und nehmen sie zum Anlass für einen wohl schon länger fälligen Kirchenaustritt. Vereinzelte wünschen sich eine Kirche mit mehr Profil und Mut zu konkreten Äusserungen. E) PATRICK MOSER ist Pfarrer der evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Saanen BE zu 1: Es ist richtig, wenn sich Vertreter der Kirchen zu politischen Vorgängen äussern. Die Bibel ist ja nicht apolitisch. Wenn allerdings die Verlautbarungen von Kirchenvertretern praktisch mit dem Programm einer Partei übereinstimmen, ist das alarmierend. Es zeigt sich darin ein gefährlich undifferenziertes Denken: Theologie geht in gängigen, politisch-korrekten Denkmustern auf und macht sich so entbehrlich. zu 2: Dass sich Kirchenfunktionäre mehrheitlich links äussern, ist unbestritten. Oft wird sozialistisches mit sozialem Engagement verwechselt. Das Evangelium kann nur zusammen mit der mosaischen Gesetzestradition verstanden werden. Die sozialen Forderungen des Mose sind allerdings weit gerechter als jedes sozialistische Programm. Rechte Positionen sind etwa der Vorrang der Würde des Einzelnen vor dem Kollektiv, der Schutz des Privateigentums und der Vater- Mutter-Kinder-Familie. zu 3: Unterschiedlich. Aber die Tendenz ist deutlich. Man hört weg. F) MARIANNE HÄCHLER ist Pfarrerin der evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Meikirch BE zu 1: Die Kirchen sollen in erster Linie evangelisieren, das Innere des Menschen im Auge behalten. Wenn sich dieses verändert, dann ändern sich auch Verhältnisse. Und diese können politischer Natur sein. Aber dann wird nicht um politische Ansichten gestritten, um des lieben Ansehens willen, sondern als Folge einer Beziehung „politisiert“, die sich heilvoll in der Welt manifestieren soll. zu 2: Jesus mit seinem Anspruch, das Heil nicht nur den Juden zu bringen, war ein antiker Globalisierer und seine Nachfolger desgleichen. Er behandelte Freund und Feind, Arm und Reich, Alt und Jung, Inländer und Ausländer gleich. Deshalb kann man nicht von einem nationalen politischen Bewusstsein sprechen. Sein Hauptanliegen war, Menschen jeder Rasse, unbeachtet von Status und Zugehörigkeit mit seinem Vater zu versöhnen. zu 3: ch habe nur eine Erfahrung diesbezüglich gemacht, als es im Eigentlichen um Religionszugehörigkeit ging und nicht um Politik. Das Thema war die Auserwählung Israels und der Zusammenhang mit unserem Christsein. Eine heftige Reaktion, die darauf folgte, zeigte, dass dies scheinbar ziemlich politisch war und dass Israel ein explosives Thema auch im Gottesdienst ist. G) BERNHARD ROTHEN ist evangelisch-reformierter Pfarrer am Münster in Basel zu 1: Die Glieder der Kirche leben in dieser Welt immer eingebunden in politische, wirtschaftliche, kulturelle Mächte. Sie müssen sich diesbezüglich ein Urteil bilden. Die Predigt leistet dazu einen wichtigen Beitrag. Alle Reformatoren haben aktuelle Fragen aufgegriffen und mit Hilfe des Bibelwortes Wegweisung zu bieten versucht. Auch heute darf sich ein Pfarrer – trotz aller Gefahren – nicht um diese Aufgabe drücken. zu 2: Die Pfarrerschaft stand traditionellerweise auf der Seite der Herrschenden. Mit den Machtverschiebungen nach dem 2. Weltkrieg schwenkte sie auf die politisch linke Seite. Das Neue Testament sagt aber deutlich, dass dieser Äon vergeht und darum jedes politische Programm, das eine vollkommene Freiheit und Gerechtigkeit verspricht, irreführend ist. Das gilt für das liberale wie das sozialistische. Das zweite der Zehn Gebote gibt einen Rahmen für das, was politisch einzufordern ist. zu 3: Sie schätzen es, wenn ihr Pfarrer in den Predigten mit biblischen und kulturgeschichtlichen Argumenten Klärungshilfen zu aktuellen Fragen bietet und so auch aufzeigt, dass das Bibelwort eine aktuelle Adresse in uns heutigen Menschen hat. Dabei ist aber wichtig, dass sich der Pfarrer nicht von den modernen Ideologien leiten lässt, nach denen „alles Politik ist“.
Kirche wieder auf den rechten Weg bringen
Umfrage bei Pfarrern
Fragen an Pfarrerinnen und Pfarrer
2. Oft wird behauptet, die Kirche mache links-grüne Politik. Ist denn das Evangelium eher links? Gibt es Ihrer Meinung nach auch rechte Positionen? Inwiefern lässt sich aus dem Neuen Testament in gängigen Kategorien politisieren?
3. Wie reagieren die Mitglieder Ihrer Kirchgemeinde auf politische Stellungnahmen der Kirche?Antworten
Datum: 27.07.2004
Autor: Fritz Herrli
Quelle: idea Schweiz